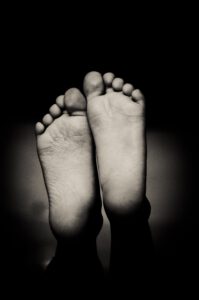Aber nicht sofort, denn das will gut gelernt sein, dafür werde ich mir drei Jahre Zeit nehmen.
In dieser Zeit werde ich mich zum Heilpraktiker und Chiropraktiker ausbilden lassen, um dann ab 2026 Chiropraktik anbieten zu können. Warum? Das ist relativ einfach. Bereits seit 2006 hat es mich immer gestört, dass ich Kunden, die eine Problematik haben, zum Therapeuten schicken muss. Gerade in den letzten Jahren habe ich auch vermehrt Kunden nach Verletzungen bei einer Art Reha betreut. Hinzu kommen “normale” Kunden mit Problemen z.B. im Rücken. Das funktioniert im Training gut und oft kann ich helfen. Aber natürlich können dabei auch mal hartnäckige Probleme z.B. in Gelenken auftreten, diese darf und kann ich dann nicht behandeln. Das wird sich ändern und wenn alles nach Plan läuft, kann ich ab 2026 alles rund um das Thema Training, Chiropraktik und Ernährung anbieten. Die Ausbildungen sind bereits gebucht und starten zeitnah, ab 2024 fange ich an leichte Problematiken, die ich behandeln darf und kann, zu lösen.